von Matthias Zwack
Jenseits der Linksparteidebatte mal ein kleiner Themenwechsel aus einem relativ aktuellen Anlass, nämlich einem 50jährigen Jubiläum der ganz besonderen Art. Vielleicht hilft er dabei, städtische Strukturpolitik im Allgemeinen und evtl. auch so manche politische Eigenheiten im Süden dieser Republik genauer zu verstehen…
München gilt heute eher als eine ruhige, ordentliche – ja: fast schon provinzielle – Stadt, als sprichwörtliches „Millionendorf“. Und das völlig zurecht: Im Vergleich mit anderen Millionstädten kann die bayerische Landeshauptstadt gewissermaßen als nahezu klinisch sauber gelten: zwischen renovierten Wohngebäuten und gläsernen Bürokomplexen, teuren Cafés und schicken Modeboutiquen findet sich kaum Raum für ein Leben außerhalb des kapitalistischen Alltags von Arbeit und Konsum. Aufrechterhalten wird dieses gelenkte Dasein der Münchner seit Jahrzehnten durch eine rigorose städtische Ordnungspolitik aus Verbotsmaßnahmen und Privatisierungswahn. „Sicherheit“ und „Ordnung“ bestimmen die politische, soziale und ökonomische Architektur der Isarmetropole wohl mehr als alles andere: angesichts der hohen Lebenserhaltungskosten, vor allem der astronomischen Mietpreise, die durch die forcierte Förderung von Eigentumswohnungen städtischerseits gefördert werden, können sich fast nur Wohlhabende, am besten mittelständische, „deutsche“ Familien, den Luxus, im vollen Umfang am gesellschaftlichen Leben dieser Stadt teilnehmen zu können, leisten.
Kameras in öffentlichen Räumen, Ordnungsauflagen und die allgegenwärtige Polizeipräsenz, welche rund um die Uhr vor allem Jugendliche, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen in prekären Lebensverhältnissen wie Obdachlose und HartzIV-Empfänger kontrollieren und von den öffentlichen Plätzen verscheuchen sorgen, disziplinieren die urbane Gesellschaft anhand dieser gesellschaftlichen Leitbilder und schließen alternative Lebensentwürfe mehr oder minder aus. Rauchverbot, Sperrstunden, „Viertelaufwertungen“ – die Liste ließe sich ewig weiter führen. München ist eine Stadt, in der es keine Unreinheiten gibt, kein Müll, kein Graffiti, keine Obdachlosen auf der Straße, eine Stadt, in der man Angst davor hat, Nachts in einer menschenleeren Gegend ohne Verkehr bei Rot über die Straße zu gehen.
I. Der spontane Aufstand
Angesichts dieser Verhältnisse, die im Übrigen weder bei Einheimischen noch Besuchern größere Verwunderung auslösen können – was soll man auch sonst erwarten bei der Hauptstadt dieses erzreaktionären Ländchens im Süden der Republik, wo die Uhren irgendwo zwischen 1920 und 1945 stehen geblieben zu sein scheinen – erscheint es heute fast seltsam, wenn darauf hingewiesen wird, dass ausgerechnet hier vor 50 Jahren, also noch Jahre vor 68, einer der größten Proteste in der Geschichte der jungen Bundesrepublik seinen Verlauf nahm. Und das in der Adenauer’schen Restaurationszeit, einer Zeit also, die gemeinhin zurecht als von einem sehr angepassten, wertkonservativen, patriarchalen und antidemokratischen Klima geprägt gilt. Angefangen hatte alles relativ harmlos: am 21. Juni wurde eine Gruppe von fünf Straßenmusikanten, die die Cafés um sich herum mit folkloristischen Weisen aus Osteuropa beglückte, von einer Polizeistreife verhaftet, weil sie noch nach 22.30 Uhr öffentlich musizierten. Was daraufhin folgte war ein fünftägiger Aufstand von jugendlichen und nicht mehr ganz so jungen Studierenden, Akademikern, Künstlern und Arbeitern, in dem die Verhältnisse in Schwabing völlig außer Kontrolle gerieten: zu erwähnen sind hier nicht nur die erbitterten Straßenschlachten mit den Ordnungshütern, sondern auch das Verhalten der Protestierenden, die auf einmal jegliche gesellschaftlichen Regeln wie Anstand, Klasse und Geschlechterrolle missachteten, feierten, tanzten, die öffentliche Ordnung lahm legten und sich im Univiertel eine kleine temporäre autonome Zone schufen.
Die Stadt reagierte daraufhin mit aller Härte: die eingesetzten Beamten ergingen sich in regelrechten Gewaltexzessen, die sich auch im zunehmenden Maße gegen unbeteiligte Anwohner richteten: berittene Polizeieinheiten ritten Protestierende nieder und Leute wurden reihenweise von Beamten mit Knüppeln verprügelt. Unter den Opfern der Polizeiknüppel befanden sich etwa auch der zur Vermittlung angereiste Leiter des städtischen Jugendamtes. Besonders peinlich: auch den us-amerikanischen Vizekonsul erwischten die Schlagstöcke übereifriger Beamter – und das ganze zweimal zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Situationen! Leute wurden aus den absurdesten Gründen festgenommen und Wohnungen durchsucht. Eine Dostojewski-Lektüre konnte einem etwa schon den Verdacht kommunistischer Umtsturzbestrebungen aussetzen. Durch das harte Durchgreifen der Polizei gelang es dem Staat auch, die Krawalle nach fünf Tagen einzudämmen. Es entstand ein massiver Sachschaden, ca. 400 Leute wurden festgenommen und bekamen teilweise empfindliche Geld- oder Haftstrafen.
Allerdings – von einer planmäßigen Aufstandsbekämpfung konnte bei diesem Polizeieinsatz nicht die Rede sein: so lässt sich vieles am Verhalten der Ordnungskräfte damit erklären, dass sowohl die Stadtregierung als auch die Beamten der sich damals noch in städtischer Hand befindlichen Polizei mit der Situation schlicht und einfach überfordert waren. Das hatte einerseits mit der schieren Größe des Protestes, an welchem sich insgesamt sich ca. 40.000 Menschen beteiligten, zu tun. Damit übertrafen die Schwabinger Krawalle, was Beteiligung und Intensität angeht, sämtliche Proteste in München im Zuge der 68’er-Bewegung bei Weitem. Zudem setzten sich die Teilnehmer der Krawalle sozial aus viel breiteren Schichten zusammen als die Protagonisten der späteren, in der BRD im Grunde auf einen kleinen Teil der Bildungselite beschränkten Proteste von 68. Auch hatten die Aufstände keine Organisation, keine Struktur, keine Rädelsführer und kein artikuliertes politisches Programm. Die gemeinhin geäußerte These, welche die Krawalle als bloßes Vorspiel zu 68 betrachten will, greift also völlig ins Leere. Sie offenbart aber bei den heutigen Betrachtern die selbe Ratlosigkeit gegenüber dem Phänomen wie bei den Polizeibehörden von damals. Der spontane Aufstand entzog sich jedweder Kategorie: eine amorphe und chaotische Masse und Vielfalt, gleichzeitig aber in der Lage, sich der Staatsmacht scheinbar koordiniert und kraftvoll entgegen zu stellen. Damit glichen die Schwabinger Krawalle als Bedrohungsszenario der herakläischen Hydra, jenem furchtbaren Ungeheuer aus der griechischen Sage mit seinen vielen Köpfen, welche den Helden unentwegt attackierten. Und jedes Mal, wenn der Held einen Kopf abschlägt, wachsen aus dem Stumpf zwei neue Köpfe nach.
II. Monster der Großstadt
Betrachten wir diese Hydra einmal genauer: München war nicht immer die Schlafstadt von heute. Ganz im Gegenteil – noch in den 1970er Jahren galt die bayerische Landeshauptstadt neben London als „die“ europäische Metropole alternativer Jugendkultur schlechthin. Und die Gegend um die Universität war das Zentrum dieses anderen Münchens. Zahlreiche Programmkinos, Theaterbühnen, Kneipen, Beat- und Jazzschuppen boten hier Anfang der 1960er die notwendige Infrastruktur für eine alternative Öffentlichkeit, die in der stockkonservativen Adenauer-BRD nichts Vergleichbares hatte und auch Strahlkraft weit über die Beschränktheit der bundesdeutschen Grenzen hinaus entwickeln konnte. Gerade in warmen Sommernächten tummelten sich hier Massen von jungen Leuten, die den öffentlichen Raum in ein alternatives Vergnügungszentrum verwandelten.
Dieser weltstädtische Münchner Flair basierte auf einer langen Tradition Münchner Subkulturen, die sich bis zu den künstlerischen Avantgardebewegungen Anfang des 20. Jahrhunderts, deren Protagonisten maßgeblich an der bayerischen Revolution und Räterepublik von 1918/19 beteiligt waren, zurück verfolgen lassen. Zwischen Leopoldstraße und Uni blühte seit den Zeiten der Monarchie ein sehr vielfältiges und facettenreiches alternatives Leben. Künstler und Kulturschaffende, Akademiker, Exilanten und gescheiterte Existenzen aller Coleur gaben sich hier ihr Stelldichein, feierten die Nächte in den Münchner „Räuberhöhlen“ – von denen die letzte, die „Schwabinger Sieben“ letztes Jahr einem Neubau weichen musste – , setzten wichtige politische Impulse und erprobten neue Formen des sozialen Miteinanders.
Diese alternative Subkultur sollte nicht überromantisiert werden – viele dieser sozialen Zusammenkünfte entstanden aus der Not subjektiver und objektiver Elendsverhältnisse und auch etwa völkische und antisemitische Lehren fanden in dieser Melange immer ihre Nische; nicht zuletzt war auch ein Adolf Hitler Exponent dieser Subkulturen – aber dennoch fand hier ein Leben weit ab des Alltagswahns seinen Platz, bereicherte die Stadtgesellschaft und bot vielen Menschen einen Raum. Aber auch andere prekarisierte Subkulturen konnten in diesem offenen, weltstädtischen Klima blühen: zu erwähnen ist etwa das Arbeitermilieu mit eigenen Kulturen der Selbstorganisation, eine schwule Subkultur auch schon zu Zeiten schärfster staatlicher Repression oder spezifisch in der Bundesrepublik das Milieu der Gastarbeiter, welches sich um das Bahnhofsviertel bildete und hier in einer zunächst einmal fremden und ihnen gegenüber unfreundlichen Umgebung neue Formen der Kommunikation und des Zusammenlebens entwickelte.
Diese dynamische, heterogene und letztendlich auch unkontrollierbare und damit potentiell subversive Melange einer Großstadt stellte fast zwangsweise eine Herausforderung für die städtische Ordnungspolitik dar. Und man kann nicht gerade behaupten, dass die Stadtverwaltung vor den Krawallen zimperlich mit dieser umgegangen wäre. Im Grunde genommen war auch der Funke, an dem sich die Krawalle überhaupt erst entzündeten, eine polizeiliche Routinekontrolle. Dennoch ist es im Nachhinein erst einmal erstaunlich, dass es eine solche Melange in den frühen 1960ern überhaupt gab – und das trotz des repressiven gesellschaftlichen Klimas der Nachkriegsjahrzehnte und trotz der unmittelbaren zeitlichen Nähe und somit ordnungspolitischen Kontinuität zur nationalsozialistischen „Hauptstadt der Bewegung“. Noch erstaunlicher ist jedoch, dass diese subversiven Milieus und Subkulturen in der heutigen Zeit, in der in vielen Dingen ein liberaleres und offeneres gesellschaftliches Klima herrscht, nicht mehr existieren. Irgendwas muss geschehen sein, das den Sumpf ausgetrocknet hat.
III. Die sichtbare Hand
Die geläufigste Antwort auf diese Frage ist die, dass es eben durch die gesellschaftliche Liberalisierung zu einer Einbindung dieser Milieus in die bestehende Ordnung kam. Diese Antwort hat, wie wir noch sehen werden, durchaus ihre Berechtigung. Sie ist aber, von einem ordnungspolitischen Blickwinkel betrachtet, ein zweischneidiges Schwert. Denn betrachtet man das Verhalten der Polizei während der Schwabinger Krawalle, welches sowohl von der heutigen Forschung als auch von der damaligen Berichterstattung durchgehend als sinnlos und unnötig brutal bezeichnet wurde und wird, dann fällt auf, dass es sich hierbei um eine klassische unmittelbare Repressionsmaßnahme gehandelt hat: die Perspektive der Beamten sowohl bei der ausschlaggebenden Verhaftung der Straßenmusiker als auch beim Verhalten gegen die Randalierenden war die einer Feuerwehr, welche erst dann ausrückt, wenn ein Brand gemeldet wurde, um diesen dann mit aller Macht zu bekämpfen. Und auch wenn die Definition von „Brand“ hier sehr eng gefasst wurde – schließlich wurde schon das unerlaubte Musizieren auf der Straße als ein solcher gewertet – hatte diese Repressionspolitik einen stark gewährenden Charakter, ganz ähnlich der Feuerwehr, die untätig bleibt, solange der Brand nur schwelt.
Herakles löste sein Monsterproblem bekanntermaßen durch die Zuhilfenahme einer Fackel: immer, wenn er einen Kopf abschlug, brannte er den Stumpf aus, damit keine weiteren nachwachsen konnten. Und angesichts der Eskalation der Krawalle und der darauf folgenden Proteste in der Öffentlichkeit war die Stadtregierung allerdings dazu gezwungen, Konsequenzen zu ziehen. Sie tat dies in Form einer grundsätzlichen Umgestaltung ihres Sicherheitsdispositivs. An Stelle der unmittelbaren Repression bei akuter Gefahr – oder dem, was die Ordnungsmacht für eine solche halten mochte – trat die Idee der präventiven Vorbeugung: kleineren Gefahrensituationen gegenüber sollte die Polizei zukünftig toleranter und vor allem diskussionsbereiter handeln, bei größeren aber umso heftiger. Vor allem aber sollte die Koordination der Beamten untereinander sowie das Netz der Kontrollen über die Ziele des Polizeieinsatzes erhöht und verfeinert werden. Statt wie bisher durch die Eskalation der unmittelbaren Gewalt einen Abschreckungseffekt zu gewährleisten, sollte dieser bereits vor der Eskalation wirken. Dies sollte unter anderem etwa durch ein geschlossenes Aufttreten der Polizei und eine lückenlose Überwachung und Vorkontrolle gewährleistet werden.
Diese Maßnahmen, die unter der Bezeichnung „Münchner Linie“ bald bundesweit Schule machen sollten, zielen auf einen Disziplinierungseffekt der Zielgruppe ab: Einerseits wird durch Dialogbereitschaft im Voraus die Spannung genommen, anderseits bewirkt allein die Kombination aus Überwachung und Einschüchterung durch massive Polizeipräsenz ein gewisses Maß an sozialer Selbskontrolle aus der Angst heraus, mit der Staatsmacht selbst konfrontiert zu werden. Und hier offenbart sich die Zweischneidigkeit: das Konzept polizeilicher Willkür im Einsatz wurde durch ein Konzept planmäßiger Überwachung und Eingrenzung ersetzt. Zwar flossen hierbei auch deeskalative und diskursive Konfliktlösungsstrategien mit ein, gleichzeitig bedeutete es aber auch die Ausweitung und Verfeinerung polizeilicher Disziplinarmaßnahmen. Aus dem Prinzip einer Macht, die erst dann einschreitet, wenn es brennt, wurde das einer Macht, die die Menschen auch im Alltag begleiten soll. Der vollbepanzerte, im Spalier schreitende „grünen Block“, welcher jede Demo begleitet, ist somit ebenso ein Produkt der staatlichen Reaktion auf die Schwabinger Krawalle wie der Polizeihubschrauber, der an warmen Sommernächten täglich über die Isar fliegt, um die am Isarufer Grillenden und Feiernden zu überwachen.
IV. Mein Freund der Plan
Interessant ist auch, dass dieser ordnungspolitische Paradigmenwechsel nicht etwa von einer irgendwie konservativen Stadtregierung durchgesetzt wurde. Ganz im Gegenteil galt die SPD-Regierung unter den „zweiten Gründer der Stadt“ Hans-Jochen Vogel damals als Paradebeispiel linker Stadtpolitik in der BRD: die Administration Vogel setzte sich damals offen und ehrlich für ein demokratisches, offenes, und ja – auch sozialistisches München ein. Entscheidendes Merkmal der Ära Vogel war eine Stadtverwaltung, und Stadtplanung, welche auf der Umverteilung städtischen Reichtums von Oben nach Unten, sowie der Modernisierung der städtischen Infrastruktur zum Wohl Aller basierte. Bestes Beispiel sind hierfür die riesigen Wohnprojekte dieser Zeit. Das Beispiel Neuperlach etwa – heute ein unattraktives Betonghetto an der Münchner Peripherie als Abschiebeort für sozial Deklassierte – zeigt dies ganz deutlich: hier sollte neuer Wohnraum für mehr als 100.000 Menschen geschaffen werden. Doch wollte man sich nicht nur mit billigen Wohnungen begnügen, sondern auch eine eigene sozialdemokratische Musterstadt im Sinne einer Einheit von Wohnen, Konsum, Freizeit und Arbeit schaffen, eine Stadt nach humanistischen Gesichtspunkten, in der Menschen ungeachtet ihres sozialen Status glücklich werden sollten. Dabei nahm man sich auch ungeschminkt Anleihen aus der Welt des real existierenden Sozialismus: nicht nur, dass die Straßen und Plätze dort heute noch nach Marx, Engels, Luxemburg und Liebknecht benannt sind, auch die Planung wurde durch das selbe Architekturbüro ausgeführt, welches auch für die Gestaltung der Ostberliner Stalinallee verantwortlich war.
Historisch betrachtet waren Projekte wie Neuperlach allerdings zum Scheitern verurteilt. Die Ursache lag in der Vorstellung begründet, dass man so etwas wie eine Idealstadt planen könne, welche die Bürger dann, so denn sie erst einmal errichtet wurde, annehmen und sich anhand der gegebenen Strukturen auch verhalten würden. Das Ziel dieser Planungsutopien war es also nicht nur, die Neue Stadt nach Wunsch, sondern eben auch mit ihr einen Neuen Menschen nach Wunsch zu schaffen. Das Ausmaß der Vogel’schen Bemühungen in dieser Hinsicht war betrachtlich: durch verschiedene Generalpläne, etwa den „Gesamtplan zur Behebung der Wohnungsnot“ und den „ersten Münchner Plan“, welchen bis Anfang der 1980er Jahre zwei weitere folgten, die das Leben der Münchner in immer größeren Maße regulieren wollten, wurde ein Großteil des städtischen Budgets in Anspruch genommen. Die Einführung der Münchner Linie kann in diesem Kontext nur als Bestandteil dieser Planungswut gesehen werden: die darin aufgeführten Denkmuster entsprechen genau dieser Verwaltungsideologie. Und auch hier ging es darum, die Aufständigen von vornherein zu disziplinieren und anzupassen.
Allerdings darf ein einzelnes Ereignis nicht überbewertet werden: bezogen auf die vorher dargestellte Melange alternativer Stadtkultur brauchte die Stadt München nach den Krawallen noch ganze 2 Jahrzehnte um den „Sumpf“ öffentlicher Alternativkultur in München endgültig auszutrocknen. Dieses Meisterstück war erst den Stadtregierungen Kiesl (CSU) und Kronawitter (SPD, auch einer der Wegbereiter des „Asylkompromisses“ von 1992), und zwar unter der Zuhilfenahme neoliberaler Konzepte wie der „Stadtaufwertung“ durch forcierte Privatisierung des öffentlichen Raumes gelungen. Allerdings konnten beide Bürgermeister dabei nahtlos an die Ordnungspolitik ihrer Vorgänger anknüpfen. Einen politischen Bruch in der Münchner Odnungspolitik hat es seitdem nicht mehr gegeben: der Neokonservative Kiesl übernahm die Konzepte des Neoliberalen Kronawitter, der Neoliberale Kronawitter die des Bürokraten Vogel, unter dessen Regierung die Schwabinger Krawalle stattfanden. Und auch heute noch gibt es keine Unterschiede zwischen der SDP-Stadt München und dem CSU-Staat Bayern, was die Durchsetzung der öffentlichen Ordnung in „ihrer“ Stadt anbelangt.
***
Zusammengefasst haben wir es mit den Schwabinger Krawallen mit einer politischen Auseinandersetzung zu tun, die durch die herkömmlichen Interpretationsmuster des Politischen nicht gedeckt werden können: hier ging es weder um einen Konflikt zwischen politischen Meinungen noch um einen von sozialen Schichten oder Klassen; was die Schwabinger Krawalle so unmittelbar politisch ist, ist, dass in ihnen ein Grundkonflikt moderner Gesellschaften ausgetragen wurde: ein Konflikt zwischen individueller und kollektiver Selbstbestimmung und sicherheitsstaatlicher Disziplinarmacht. Ordnungspolitisch gesehen haben uns die Krawalle etwas hinterlassen, das bleibt. Die Beschäftigung mit ihnen ist von daher nicht nur bloße Erinnerungspolitik, sondern Teil einer politischen Auseinandersetzung, die wir heute in Zeiten des „gläsernen Bürgers“ mehr führen müssen als je zuvor. München kann dabei nur als Paradebeispiel gelten, als Avantgardestadt, in der die eine Seite letztendlich gewonnen und triumphiert hat. Vorerst zumindest.
Zum Schluss noch eine kleine Anregung: die Schwabinger Krawalle wurden dadurch ausgelöst, dass sich ein paar Straßenmusikanten nicht an die rechtlichen Ruhezeiten hielten. Niemand stellte aber das grundsätzliche Recht der Musiker, ihre Vorstellung auf der Straße anzubieten, in Frage. Heute hingegen geht öffentliches Musizieren in München nur mit Genehmigung. Diese kostet 10 Euro. Pro Tag werden von der Stadt maximal zehn Erlaubnisse an festgelegten Standplätzen erteilt, fünf Vormittags und fünf Nachmittags. Jede Gruppe darf sich höchstens 60 Minuten an einem Standort aufhalten. Grundsätzlich kann jede Gruppe höchstens zweimal in der Woche berücksichtigt werden. Erlaubte Spielzeiten sind nur zwischen 11 bis 14 und 15 bis 22 Uhr. Blasinstrumente, Schlagzeuge, Sackpfeifen, Drehorgeln, Keyboards, elektronische Musikinstrumente und Verstärker dürfen nicht verwendet werden. Die Mitglieder von Musikgruppen über fünf Personen müssen sich in einer speziellen Musikantenkartei registrieren lassen. Musiker müssen vor Erlaubnis erst in der Stadtinformation vorspielen. Die Stadt München gibt auf ihrer Internetseite allerding an, dass sie sich „grundsätzlich über Ihr Spiel und Ihre Darbietung“ freut.
(mz)

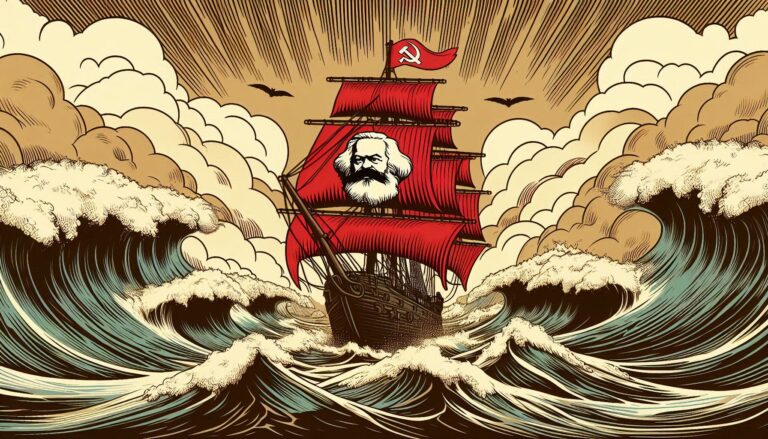
Sorry, hatte grad anderes zu tun und grad auch nicht so viel Zeit. Rekommunalisierung bedeutet, dass die Oberhoheit über Struktur, Personal und Aufgabenbereiche der Polizei wieder vom Staat an die Stadt zurück fallen wie es vor Ende der 1970er Jahre der Fall war. Die Finanzierung sollte aber weiterhin der Staat übernehmen, weil die Kommunen das kaum stemmen könnten.
Hauptvorteil wäre eine lokale demokratische Kontrolle über die Polizeiarbeit und polizeiliche Richtlinien. Eine solche Kontrolle ist meiner Ansicht nach in München vor allem Aufgrund der oben skizzierten starken Stellung der Polizei in der Stadt notwendig. Denn in der Münchner Stadtpolizei herrscht derzeit eine gewisse Kolonialherrenmentalität vor; die Beamten auf Streife gehen an die Stadt und ihre Bürger ran, als befänden sie sich in einer feindlichen Umgebung voller potentieller Gefahrenquellen und diese Sichtweise wird den Beamten intern auch genauso vermittelt.
@mz:
Könntest du das bitte erklären, wie du dir das gedacht hast?
Ich verstehe nicht ganz, welchen Vorteil eine Rekommunalisierung der Polizei haben sollte oder wie diese aussehen könnte.
Ah ja, darum gehts!
Wie sieht’s denn mit genügend Sitzplätzen im öffentlichen Raum incl. ÖPNV aus?
Als Gehbehindertem fehlt mir das Angebot früherer Zeiten, an dem eben auch „Penner“ partizipiert haben, was mich aber nur sehr selten und weit unterhalb irgendwelcher „Maßnahme-Schwellen“ gestört hat.
Es gibt zwar noch was, aber um ca. 80 % reduziert, gegenüber sagen wir: 1985.
Dafür gibt’s vom Bezirk heutzutage bis zu 2400 -Taxi-KM pro Jahr frei (nur bestimmte Taxi-Unternehmer bzw. Transporteure wie Rotes Kreuz, AWO usw.) oder 170 Euro/Monat
für freie Taxi-Wahl, deren Fahrer dann nicht den „Großen Erste-Hilfe-Schein“ haben müssen).
Und da wundert man sich über’s Dickwerden: früher bin ich von Bank zu Bank geschnauft (wg. Schmerzen), heute nehm‘ ich mir gleich ein Taxi.
Gegen saubere öffentliche Toiletten habe ich an sich auch nichts – sehr wohl aber gegen den Diskurs, der angestoßen wird, wenn man kommunalpolitisch diese zum Hauptanliegen macht und alles andere darunter subsumiert. Dann geht es nämlich sehr schnell gar nicht mehr um die Sanitäranlagen, sondern um eine generelle Stadt-Hygiene, die durchaus an einen städtischen Ordnungsdiskurs im Sinne einer Sozialhygiene anschlussfähig ist.
Damit meine ich nicht nur eine Stadt frei von Obdachlosen, Jugendlichen oder „ausländisch“ wirkenden Menschen – das wäre dann schon die höhere Stufe, die ich der Münchner Partei definitiv nicht unterstellen möchte – sondern das Problem fängt durchaus bei den Toiletten an: Die Stadt München geht derzeit das Problem Sauberkeit auf öffentlichen Sanitäranlagen hauptsächlich dadurch an, dass die öffentlichen Toiletten entweder zahlungspflichtig gemacht oder gleich ganz geschlossen werden. Sauberkeit bedeutet dabei quasi Privatisierung (auch bei Schließung übernehmen dann halt die umliegenden Lokale die Aufgabe, Klos bereit zu stellen) = soziale Exklusion. Und solchen Trends zu begegnen kann und muss sehr wohl eine kommunalpolitische Aufgabe sein.
Na das sind ja durchaus Themen dabei, z. T. mit überregionaler Bedeutung (Polizei).
Zu der aktuellen und eher verborgenen Situation Müncher Situation kann ich nix sagen,
Gentrifizierung von unten usw. Hier in Nbg/Fürth ist dergleichen sehr planiert und viel zu besetzen
gibt’s gar nicht, weil nicht lange „nutzungslos“. (Ich komme aber auch nicht mehr viel rum hier …)
Zwischennutzungsrechte für und Fehlbelegungsabgaben an (Sub-) Kultur- u. a. „Tertiär“-Sektoren in Verbindung mit massiver Lockerung/Behebung von Belebungshemmnissen.
Gegen gute Hygiene & meinetwegen „saubere“ Ästhetik im öffentlichen Sanitärbereich ist nichts einzuwenden!
p.s.: Die personalfreie Wasserstoff-Tanke hatte ich erwähnt, weil ihr tägliches Im-Blick-Sein stets jene Gefühle von „Leere“ und damit Langeweile hervorruft, wie manche Hopper-Gemälde aus früherer Zeit, z. B. „Nighthawks“ o. so ähnlich, bloß extrapoliert die Zukunft, wie sie in den 60ger & 70ger Jahren so vorgestellt wurde, Automatenshopping, „Raumpatroullie Orion“ usw.
Gegen die hohe Stumpfsinn-Konzentration der in München versammelten Tech- & Kommerz-Eliten ist aber wohl kein KOMMUNALPOLITISCHES Kraut gewachsen …
Ach ja: wegen den politischen Zielen der Nach-Ude-Zeit: leider hält sich unser Kreisverband, sowie die Stadtratsfraktion mit der Formulierung von Änderungsvorschlägen angesichts dieses Themas bisweilen vornehm zurück bzw. gießt sogar noch Öl ins Feuer/Reiniger ins Klo – siehe die Debatte zur Sauberkeit öffentlicher Sanitätseinrichtungen des neuen Kreisvorsitzenden. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass diese Verhältnisse im Münchner Blick so alltäglich und normal wirken, dass keinem mehr die Idee kommt, dass da irgendwas falsch läuft.
Auch ich könnte dir hier an dieser Stelle bisher nur sehr allgemeine Vorschläge liefern: wichtig ist, denke ich mal, eine Stadtpolitik, die „von Unten“ kommt. Das bedeutet vor allem die Schaffung von Rahmenbedingungen für größere Freiräume, etwa durch den massiven Abbau von Verboten und Vorschriften, die sozial verträglich allen zu Gute kommen. Ich könnte mir etwa eine Maßnahme vorstellen, dass öffentlicher Raum, sowie der Raum in Unternehmen in städtischer Hand grundsätzlich, sofern die Nutzungsabsicht unkommerziell ist, von allem und jedem kosten- und kontrollfrei genutzt werden darf. Das beträfe dann nicht nur große Freiflächen wie Englischer Garten, Olympiapark und Isarufer, sondern auch leerstehende Gebäude und Fabriken etc. bis hin zu den U-Bahn-Stationen.
Zweitens müsste das Klima in der Stadt sozial verträglicher gestaltet werden. München ist teuer und da hat die Stadt nur begrenzte Eingriffsmöglichkeiten. Ein forcierter Bau von offenen Genossenschaftswohnungen wäre beispielsweise chick, genauso kostenloser öffentlicher Nahverkehr, die flächendeckende Errichtung von Antennen für freie Netze oder eine demokratisch kontrollierte Energieversorgung.
Das sind aber nur so ein paar Ideen bisher. Und manche, die ich für notwendig erachte, werden wohl vorerst eher Wunschträume bleiben, etwa die Rekommunalisierung der bayerischen Polizei oder ein Nutzungsrecht privatwirtschaftlicher Gebäude ähnlich dem in Großbritannien oder Holland, nach dem es möglich ist, auch leerstehende private Gebäude und Einrichtungen zu okkupieren und für sinnvolle Zwecke (z.B. Wohnen) zu nutzen.
Danke für deine ausfühliche Antwort. 🙂
Zum Ude-Konnekt: das ist für mich gar nicht so leicht, denn als Historiker hört für mich die erzählte Geschichte bei Kronawitter auf. Ude ist dann für mich schon was persönlich-biographisches, deswegen maße ich mir da keine differenzierte Meinung an. Obwohl das nähere Eingehen auf Subjektivitäten doch recht interessant sein könnte – meine Erfahrung deckt sich da ziemlich gut mit dem, was dir deine nach München gezogenen Freunde berichten: München ist langweilig und das tut nicht gut, kann nicht gut tun, ist sogar meiner Ansicht nach höchst gefährlich, weil diese Stadt langsam aber sicher im Begriff ist, als urbaner Raum abzusterben. Das eigentlich Brisante daran ist aber, wie du auch bemerkt hast, dass sich in München nur frühzeitig und beschleunigt Prozesse durchgesetzt haben, die auch auf andere Städte wirken. Ich würde fast behaupten, München ist die Zukunft (post-)moderner Großstädte überhaupt, sofern sich nicht bald ein erneuter Paradigmenwechsel in Form einer Stadtpolitik „von unten“ durchsetzt.
Aber nun mal ein Versuch, zurück zu Ude zu kommen: mein Eindruck ist, dass die Administration Ude ebenso nahtlos an die Kronawitters ansetzt, wie dieser an Kiesl, Kiesl an Kronawitter und Kronawitter an Vogel. Ude verschärfte das neoliberale Paradigma des Rückzugs der Stadt aus den kommunalen Aufgaben noch weiter. Stadtpolitik unter Ude, das heißt, dass der OB sich politisch darauf beschränkt, manchmal neue Gebäude eröffnen und auf dem Oktoberfest das erste Bierfass aufzustechen, während die Kontrolle und Überwachung des öffentlichen Raumes von der städtischen Bürokratie und der bayerischen Polizei im Alleingang organisiert wird. Alles andere ist Aufgabe privater Investoren. Das ist aber nur eine weitere Episode in der Tendenz der Einbindung der Privatwirtschaft in die städtische Planung, die bereits unter Kiesl und Kronawitter vorgezeichnet wurde.
Ein Aspekt, den ich, besonders in Hinblick auf die Frage, wieviel „Subkultur“ es in einer Stadt „braucht“ oder „haben muss“ – eine Frage, die sich aus ordnungspolitischen Aspekten übrigens nicht stellt; hier geht es lediglich darum, ob es so etwas gibt oder nicht und wie die Stadt damit umgeht – unterschlagen habe, ist allerdings der der aktiven Beteiligung von Teilen der Stadtbevölkerung an ordnungspolitischen Planungsprojekten. Eine Stadt ist in ihrer Bevölkerung ja kein homogenes Gebilde; dem entsprechend gehen auch die Meinungen über das gewünschte Wesen einer Stadt weit auseinander. Und in München hatten z.B. die „Heimatschutz-Bewegungen“ der 1970er Jahre einen wesentlichen Anteil daran, dieser Subkultur aus einer „demokratischen“ Perspektive heraus den Kampf anzusagen. Diese wandten sich aus einer sehr konservativ-traditionalistischen Sichtweise gegen die Vogel’schen Modernisierungsprojekte und forderten eine „demokratische Mitbestimmung“ der Einwohner am Stadtleben ein. Im Zentrum dieses Kampfes stand das Wort „Lebensqualität“, welche von den Bewegungen damit besetzt wurde, dass eine Stadt erst dann lebenswert ist, wenn sie so bleibt, wie sie früher angeblich mal war. Sprich: saubere, altmodische und aufgeräumte Viertel. München sollte nach ihrer Vorstellung eher einem typischen bayerischen Dorfkern gleichen. Durch diese Kehrtwende im öffentlichen Diskurs wurden auf Einmal die Gegensätze Vogel’sche Planungseuphorie und alternative Subkultur in einem Topf geworfen. Nicht zuletzt aufgrund dieser historischen Erfahrung bin ich heute grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber lokalen Antigentrifizierungsbewegungen, auch wenn ich mich grundsätzlich mit ihrem Anliegen solidarisiere und dort mitwirke.
Ein anderer Aspekt in eine ähnliche Richtung ist der der Gentrifizierung „von unten“, also der Prozess, dass die Künstler, Autonomen und Alternativen von heute die Gentrifizierer von morgen sind, indem sie die Viertel aufwerten. Auch dieser Prozess ist in München anhand von Vierteln wie dem Glockenbachviertel, Haidhausen und aktuell Westend nachvollziehbar. In diesem Fall haben wir also alternative Gegenkultur, die sich selbst abschafft.
Sehr interessant, aber könnte man/könntest Du einen Konnekt zur Ude-Zeit nachliefern, sowie politische Ziele und Möglichkeiten der kommenden (Post-Ude) Zeiten finden/evaluieren?
Wieviel „Subkultur“ soll München haben, wieviel MUSS es?
Darf/kann man so eine Frage überhaupt stellen? Wenn ja, ist gewiss darauf zu achten, mögliche positive Rückkopplungen verbesserter Verhältnisse auf den/die Menschen (dort, „als solche“), nicht wieder in die „Planung“ und auch nicht in die Zielsetzung aufzunehmen: Ermöglichen ja, einkalkulieren, einplanen oder zum Ziel setzen: nein.
Persönlich habe ich von (Ex- bzw. Schulzeit-) Freunden, die es dahin verschlagen hat, und aus der Berufstätigkeit in solchen Läden wie Siemens‘ „center of excellence“ (draussen am Flughafen, gegenüber der personalfreien Wasserstoff-Tanke) in der Tat auch den Eindruck, daß sich viele Leute dort ganz schön langweilen, – was ihnen nicht wirklich gut tut.
Wer nicht in den „schönen, guten“ Verhältnissen versackt, – „Biergarten“-Idyllen haben sich z. B. für nördlicher sozialisierte/klimatisierte Leute auch schon als böse Fallen entpuppt – , wer also als Münchner nicht in München versackt, der fliegt in der Republik und der Welt herum, und erzählt anderen, wie man die Dinge regelt, – auf münchnerische Art bzw. „made in Germany“.
Darin zweiter Platz nach Berlin. Dort geht bald gar nichts mehr, wie der Rücklauf auf die Martenstein-Glosse aus dem Zeitmagazin anzeigt. Vor allem den Berlin-Externen, die dort bloß beruflich zu tun haben, scheint das aufzufallen, den Berlinern selbst offenbar deutlich weniger. Vielleicht kann man darin auch eine „Veröstlichung“ Berlins erkennen: Schon lange vor der DDR waren im Osten die jeweiligen Zentralknoten der gesellschaftlichen Stratifikationen „taub“ gegenüber den „Störungen“.
Ohne Störungswahrnehmung keine Verbesserung: daraus folgt Rückständigkeit, sehr feste Feudalstrukturen gehen erst spät in Staats- und Autoritätsgläubigkeit sowie Klientelismus über, geringere Wirtschaftskraft (Böden, geogr. Marktferne, z. T. ungünstige Gewässerstrukur/Transport-wesen) als im Westen bedingt (schon vorkapitalistisch) relative Armut z. B. zum Rheinland.
Zum Störungsbegriff siehe auch Dirk Baecker.
Zum Ertaubungsphänomen „dos“, zuletzt im Kommentar zu:
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/im-gespraech-katja-kipping-und-bernd-riexinger-wir-sind-linkspluralistisch-nicht-eine-linke-kaderpartei-11784680.html
(sry for the poor formatting …)