Im folgenden Text wird die Dialektik zwischen der Führungskaste einer Partei und ihrer Basis analysiert. Die letztliche Ohnmacht der Basis gegenüber ihrer Führung gilt jedoch nur im ideologischen Bereich des Überbaus. Sämtliche Mitbestimmungsrechte der Basis verlieren hier ihre Macht. Doch auch eine Partei besitzt eine ökonomische Grundlage – sie ist auf die (ehrenamtliche) Arbeit ihrer Mitglieder angewiesen. Hier gibt es das Potential der Basis, ihrer Führungskaste paroli zu bieten. Stets hat sie durch die Verweigerung der Mitarbeit, d. h. durch einen Wahlboykott, die Möglichkeit, die Interessen der Führungskaste zu durchkreuzen. Ein Beispiel für solch einen Basisaufstand gibt es in der Hannoverschen FDP zum Kommunalwahlkampf 2011.
Wer sich eingehend mit einer Partei beschäftigt, wird feststellen, daß sie in zwei Klassen zerfällt: In eine Führungskaste und in die Parteibasis. Dabei ist die Führungskaste ein Konglomerat verschiedener kleinerer und größerer Führer in unterschiedlichen Parteifunktionen oder von sonstigen mit Nimbus ausgestatteten „Persönlichkeiten“ – die Parteibasis dagegen kann als Sammelbecken des Fußvolks angesehen werden; sie ist diffus und läßt sich zur Masse aggregieren.
Sobald sich eine Partei als demokratisch bezeichnet, wird der Parteibasis der „Souverän“ zugesprochen. Alles – so die Theorie – was die Partei verkörpert und wie sie agiert, läßt sich auf den Wählerwillen der Parteibasis zurückführen. Entscheidungen, die an der Spitze getroffen werden, sind nur mittelbarer Ausdruck des Basiswillens. Da, bis auf die mit Nimbus beladenden „Persönlichkeiten“, sämtliche Parteiführer in ihre Funktionen durch die Basis gewählt werden (wenn auch oftmals nur mittelbar) und eine Vielzahl von Entscheidungen von der Basis beschlossen werden, scheint die Feststellung eine Partei sei demokratisch sich zu bestätigen.
In der Praxis manifestiert sich aber ein anderes Bild. Sicher, die formaldemokratischen Prozesse werden nicht angetastet, allerdings präjudiziert die Führungskaste die Meinung der Parteibasis. Sie tut dies auf zweierlei Art. Einerseits verfügt nur die Führungskaste über einen Zugang zur Öffentlichkeit und kann hier die offizielle Parteilinie vorgeben. Zum anderen ist eine Partei ein fein verästeltes Gebilde von aufeinander abgestuften Funktionen, so daß die höhere Ebene durch Weisung ihre Meinung an die darunterliegenden Ebenen weitergibt, bis sie schließlich der Parteibasis als alternativlose Entscheidung höherer Art ihr zustimmendes Votum abverlangt. Daß eine Partei auf diese Weise agiert, liegt an dem handwerklichen Geschick der Führungskaste – nur dort, wo das handwerkliche Geschick fehlt, gleichsam ein Machtvakuum entsteht, entwickelt sich Bewegung von unten, was dann allenthalben als Auseinanderfallen der Partei, als Chaos und Anarchie wahrgenommen wird.
Natürlich muß man dieser Beschreibung, wie der Parteiwille entsteht, entgegnen, daß Parteien keine monolithischen Blöcke sind, allein die Vielzahl von Zwistigkeiten und Richtungskämpfen scheint diesem eben gezeichneten Bild zu widersprechen. Deshalb werden Wahlen und Abstimmungen durchgeführt, um den Zuspruch an die eine oder die andere Meinung zu messen – und die letzte Instanz ist dann eben die Parteibasis. Richtig an diesem Widerspruch ist, daß die Partei nicht aus einem monolithischen Oligopol besteht, sondern aus einem untereinander konkurrierenden Oligopolnetz. Innerhalb der Machtsphäre werden Bündnisse geschlossen, Intrigen gesponnen und um die Vorherrschaft gekämpft. Je nachdem, welches Interesse verfolgt wird, findet dieser Reigen arkan oder öffentlich statt.
Der jüngst zu beobachtende öffentliche Angriff auf die Parteivorsitzenden der DIE LINKE durch Funktionäre der zweiten Reihe fand deshalb öffentlich statt, um über die öffentliche Meinung eine Entscheidung zur Ablöse herbeizuführen. Ein arkanes Vorgehen über die Hierarchie der Parteifunktionäre wäre hier nicht zielführend gewesen, da einerseits dies den Parteivorsitzenden in ihrer Leitungsfunktion nicht verborgen geblieben wäre, sobald dies in den Bereich der manifesten Meinungsbildung übergegangen wäre, andererseits den Parteivorsitzenden die Waffe der Öffentlichkeit aus der Hand geschlagen werden mußte. Dagegen fand die (stille) Nominierung des aktuelle Parteivorstandes DIE LINKE in einem arkanen Bereich der Hinterzimmer statt; keineswegs wurde durch öffentliche Bewerbung um die Sitze im Parteivorstand gebuhlt, dies hätte die Partei vor die Zerreissprobe gestellt, da die verschiedenen Abteilungen des Oligopols zentrifugal gewirkt hätten. Erst nach Übereinkunft der Führungskaste über die Sitzverteilung wurde der Plebiszit der Parteibasis eingeholt – da gab es bereits keine Alternative mehr. Trotzdem gab es widerspenstigen Geist in der Parteibasis: Immerhin einer traute sich, den designierten Parteivorsitzenden herauszufordern, obwohl ihm von der Führungskaste nahegelegt wurde, darauf zu verzichten.
Dies legt zwei Dinge dar, einerseits ist eine demokratische Partei durch ihren Anspruch daran gebunden, zumindest formal ihre Funktionen frei wählen zu lassen und ihre Inhalte frei zu bestimmen. Es kann nur bedingt von oben durchregiert werden. Und andererseits existiert innerhalb der Parteibasis, trotz ihrer allgemeinen Beeinflußbarkeit und Steuerbarkeit, ein renitenter Geist. Dies läßt die Frage aufkommen, ob trotz dem scheinbar unwiederstehlichen Führungsanspruch einer kleinen Elite es möglich ist, demokratischen Widerstand gegen die Führungskaste aufzubauen. Dies ist sowohl eine Frage der objektiven Bedingungen hierfür, als auch eine Frage der geeigneten Mittel.
Offenbar ist der renitente Geist in der Parteibasis nur latent vorhanden, zu jeder Zeit gibt es einzelne die gegen die Macht aufbegehren, allerdings stoßen sie auf wenig Resonanz. Die Mehrheit unterliegt der Massenseele, die von der Führungskaste nach Belieben gesteuert wird; ein Ausbrechen aus dem gesteuerten Denken ist psychologisch nicht möglich. Dem liegt zugrunde, daß sich eine Partei als bürgerliche Öffentlichkeit konstituiert, während ein Ausbrechen aus festgefügten Machtstrukturen eine proletarische Öffentlichkeit voraussetzt, die sich nur in geschichtlichen Bruchstellen manifestieren kann. Aber geschichtliche Bruchstellen sind nicht nur gesamtgesellschaftlich denkbar, sie vollziehen sich auch im kleinen, mithin im lokalen. Es gibt partielle Brüche, meistens durch handwerkliche Ungeschicklichkeit der Herrschenden, manchmal durch geschichtliche Entwicklungen bedingt, die das emotionale Korsett der Masse durchschneidet. Macht muß sich naturwüchsig geben, damit sie nicht hinterfragt werden kann. Sobald Entscheidungen nicht mehr naturgesetzlich wirken, sondern ihren egoistischen Charakter der Führungskaste offenbaren, kann der latente renitente Geist der Parteibasis in offene Rebellion umschlagen.
Mithin passiert dies in aller Regel nicht. Sobald in einer Partei Situationen auftreten, die letztlich den gesamten Machtanspruch der Führungskaste in Frage stellen, wird von den höchsten Stellen schnell ein Machtwort gesprochen, der einerseits zur Ordnung rufen soll und andererseits beruhigend wirkt. Ein Beispiel dafür war die jüngste Hamburger Rede des Parteivorsitzenden der DIE LINKE gerade in dem Moment, wo die Intrige gegen die Parteivorsitzenden in ein großes Tohuwabohu auszuarten drohte und in der Parteibasis begonnen wurde, über den Sinn der Partei zu spekulieren. Dieser vereitelte Griff nach der Krone darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß allerorts bestimmte Teile dieser Partei fait accompli ihr Personal in Funktionen hievt, mit dem Ziel Hegemonie herzustellen und ihren Machtanspruch zu erweitern – dies gerade in den Bereichen, wo die Parteibasis ihr Primat sieht, nämlich in der Kandidatenaufstellung zu öffentlich-allgemeinen Wahlen.
Die „legitimen“ Mittel der Parteibasis, dem Machtanspruch der Führungskaste etwas entgegenzusetzen, scheinen vielfältig. Neben dem Stimmrecht und dem Rederecht hat sie ihre eigenen Versammlungsorte, sie kann sich direkt an die verschiedenen Parteiführer wenden und kann protestieren. Es ist der Verdienst der Kommunikationsguerilla den kulturellen Code entschlüsselt zu haben, der all den vielfältigen Öffentlichkeiten mitsamt ihren Beteiligungsmöglichkeiten zugrunde liegt. Dabei wird schnell klar, daß sämtliche „legitimen“ Mittel der Parteibasis, auf ihre Führungskaste Einfluß zu nehmen, wirkungslos sind. Sicherlich kann eine Eingabe eines Parteimitglieds von seinem Führer gnädig berücksichtigt werden, doch nur um den Preis, diesem die huldvolle Anerkennung seiner Macht zu bestätigen. Sobald es um die wirkliche Machtfrage geht, findet das einfache Parteimitglied keinen Zugang mehr. Letztlich dient sämtliches “legitime“ „Mitbestimmungsrecht“ der Parteibasis der Patronage durch die Führungskaste.
Selbst das Stimmrecht der Parteibasis muß wirkungslos bleiben. Sicher, die Führungskaste ist – sofern sie demokratisch bleiben will – auf die Zustimmung der Parteibasis angewiesen. Allerdings bewirkt partieller Widerspruch nichts, im Gegenteil, sie verfestigt den demokratischen Anlitz der Führungskaste nur. Insofern müßte die Parteibasis schon Geschlossenheit aufzeigen, etwas, was ihr nicht gelingen kann, da sie sich hierfür organisieren müßte. Organisiert wird aber die Parteibasis durch die Führungskaste, die sämtliche Machtmittel hierfür inne hat. Schon die Kontaktaufnahme innerhalb der Basis scheitert daran, daß sie sich untereinander gar nicht kennt und es auch systematisch verhindert wird, daß sie sich kennenlernt. Jederzeit verfährt die Führungskaste nach dem Prinzip divide et impera und stürzt die Parteibasis damit in Konfusion. Übrig bleiben allein lokale Bande, die gegenüber den größeren Zusammenhängen ebenso machtlos sind wie der Einzelne. Jederzeit sind die lokalen Zusammenhänge gegeneinander ausspielbar und müssen sich an die Führungskaste zentrieren. Sichtbar wird dies dann bei der Personalpolitik, wo zwar jeder lokale Zusammenhang seine eigenen Vorstellungen hat, wen es in Positionen bringen möchte, dies aber stets überlagert wird, durch die übergeordneten, „allgemeinen“ Empfehlungen der Führungskaste, die gleichsam ein Imperativ an die Masse ist.
Scheinbar kann die Unterlegenheit der Parteibasis gegenüber der Führungskaste nicht verhindert werden; sie scheint strukturelles Fundament der Partei zu sein. Doch eine prinzipielle Waffe bleibt dar Parteibasis doch. Zwar sind die “legitimen“ Mittel, die im Bereich des ideologischen Überbaus ansiedeln, stumpf, doch begründet sich der Daseinszweck der Partei nicht in der Herrschaft der Führungskaste über die Parteibasis, sondern an der Partizipation der allgemeinen staatlichen Macht. Im demokratischen Parlamentarismus findet der Zugang zur staatlichen Macht über die öffentlich–allgemeinen Wahlen statt. Und neben der fremdbestimmten medialen öffentlichen Meinung muß die Partei sich der Arbeit ihrer Parteibasis bedienen, um gewählt zu werden. Das Kapital der Partei beruht auf der ehrenamtlichen, freiwilligen Arbeitskraft ihrer Parteibasis, diese Arbeitskraft ist nicht kontraktlich gebunden, sondern muß eingeworben werden. Dies ist die Achillesferse der Führungskaste – denn gegen den Willen der Parteibasis findet kein Wahlkampf statt.
Viel Mystizismus wird daher aufgeboten, ein freiwilliges Arbeitsverhältnis zur Pflicht zu machen. Es wird die Einheit der Partei beschworen, der äußere Feind in den düstersten Farben bemalt und stets vor den Konsequenzen gewarnt, wenn jetzt nicht zusammengehalten wird. So wie der Arbeiter nicht streiken darf, weil sonst die Fabrik dichtmachen müsse, so muß das Parteimitglied seine Wahlkampfpflicht erfüllen, damit „seine“ Leute in die Parlamente einziehen und „seine“ Interessen vertreten. Vergessen ist plötzlich der vorangegangene Betrug der Führungskaste an die Parteibasis, die ihr die Kandidaten oktroyiert und ihre Interessen durchgesetzt hat.
Doch gerade das Bewußtwerden der Arbeit ermöglicht der Parteibasis ein Ausbrechen aus den Machtverhältnissen. So wie trotz aller Propaganda der Arbeiter dennoch streikt und damit seine Interessen durchsetzt, ist der Wahlboykott die schärfste Waffe der Parteibasis. Das Einstellen des Wahlkampfes, die Verweigerung der Stimme und die Nichtwerbung für Stimmen, die Abstinenz der Solidaritätskandidatur läßt die Führungskaste zittern – dies ist der Ausgangspunkt jeder Organisation der Parteibasis gegen die Führungskaste. Einmal erfolgreich durchgezogen demokratisiert der Wahlboykott eine Partei nachhaltig.
Es mag jetzt verwundern, daß eine Partei sich selbst boykottiert. Traditionell ist der Wahlboykott eine Waffe der autonomen Bewegung und der Anarchisten, die damit ihren Widerwillen gegen den Staat zum Ausdruck bringen. Allerdings ist bei ihnen diese Waffe stumpf. Es gibt kein historisches Beispiel, wo die Anarchisten eine Wahl zum Scheitern gebracht hätten; das Wahlvolk verhält sich hier wie eine Masse, die sich nicht gegen die Autorität auflehnen kann, weil sie ihr inhärent ist. Selbst da, wo keine echte Wahl zur Verfügung steht, folgt der Wähler dem Aufruf zur Wahl bereitwillig, so nennt Robert Michels das Referendum von 1860, wo die italienischen Kleinstaaten zu einer Nation zusammengefasst wurden: Der Wähler hatte nur die Wahl zwischen den verhaßten Duodezfürstentümer und einem Königreich unter Victor Emanuel; er konnte sich nicht für eine republikanische Staatsform entscheiden.
Auch der integrative Charakter einer Partei spricht gegen einen Wahlboykott. Eine Partei ist keine Assoziation, sondern bündelt das poltische Einzelinteresse über seine Parteibürokratie zu einem gemeinsamen politischen Willen. Dies ist auch ein Grund dafür, daß der „Abweichler“ (derjenige, der nicht dem politischen Mainstream folgt) eine so verhaßte Figur in der Partei ist. Ein Wahlboykott bedeutet, daß die Partei diesen integrativen Charakter zumindest partiell verloren hat – also daß das gemeinsame Interesse nicht mehr besteht. Aus diesem Grund würde die Führungskaste der Parteibasis auch vorwerfen, die Partei zu schädigen. Und auch innerlich steht das Basismitglied genau vor diesem Zwiespalt. Hier dringt die Rolle des kleinen Parteiführers auf lokaler Ebene in den Vordergrund: Er ist der Vorkämpfer der Partei, derjenige an dem die Organisation en détail seinen Ausdruck und seine Wirkung findet. Im militärischen Begriff ist der kleine Parteiführer der caput, das Frontschwein, das das einfache Parteimitglied bei der Stange hält. Erst da, wo der kleine Parteiführer sich von der Führungskaste betrogen fühlt und sich mit dem Basismitglied gemein macht, wird der Wahlboykott praktisch durchführbar.
Es verbleibt die Frage, ob ein Wahlboykott praktisch durchführbar ist. Es müssen hierfür zwei Faktoren zusammenkommen: Die Arroganz der Führungskaste gepaart mit handwerklichen Ungeschick bei der Durchsetzung ihres Kandidatentableaus und das Umschlagen des latenten renitenten Geists der Parteibasis in offene Empörung. Für den Kommunalwahlkampf in Hannover 2011 haben sich diese Bedingungen in der FDP erfüllt. Nachdem die Basis ihren Spitzenkandidaten für die Regionsversammlung in der Hochburg Langenhagen, Isernhagen und Burgwedel bestimmt hatte, drängte sich der prominente Ratsherr Nils Tilsen vor und übernahm die Spitzenkandidatur. Zwar verzichtet die FDP–Basis jetzt nicht auf den Wahlkampf, wird aber nicht für Nils Tilsen, sondern für ihren eigenen zweitplatzierten Kandidaten werben. Im Grunde stellt dies einen Wahlboykott gegen Nils Tilsen dar.
Das Beispiel FDP könnte als Vorlage für andere Parteien dienen. Möglicherweise kommt auch DIE LINKE in diese Lage und muß sich mit einer rebellischen Basis beschäftigen. Dies dürfte dann ein Warnschuss für alle großen und kleinen Parteiführer in der DIE LINKE bundesweit sein, daß unersättlicher Machthunger nicht mit der Parteibasis machbar ist. Ein Schritt vorwärts zu einer demokratischen Partei.
Hannover 2011, Mischa Kölle

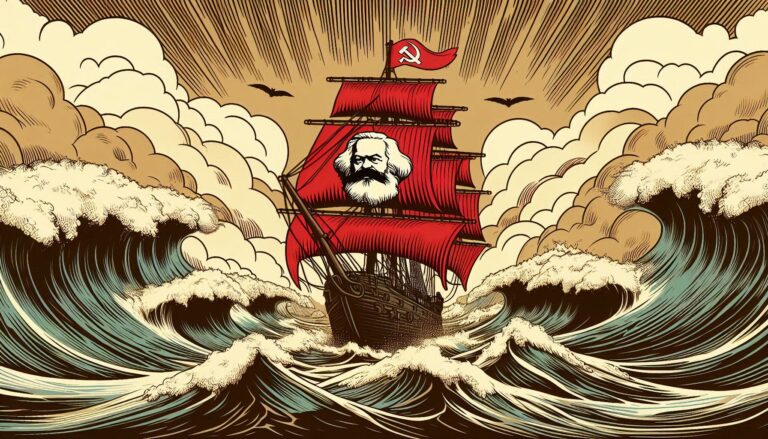
Viel zu selten wird in solchen Foren auch anerkennend kommentiert, dies will ich hier ausdrücklich nachholen. Teile die Einschätzungen von Matthias. Gleichwohl gibt es einen Unterschied zwischen einem Wahlboykott und der politischen Drohung damit, um parteiinterne Demokratiedefizite (Vorschläge zu deren Überwindung hat Matthias ja u.a. auch hier vorgetragen) zu überwinden. Daher fand ich den Text von Mischa diskussionswürdig.
Bin nicht auf 180. Und ja Du hast ja Recht, Nibelungentreue ist Sch…! Fühlte mich von dir falsch interpretiert. Lass uns beim Weinchen drüber reden. Vielleicht auf dem Fährmannsfest 🙂
Lieber Juan,
immer wenn ich die Anrede „werter Genosse“ von Euch lese, weiß ich bereits, daß Ihr auf 180 seid. Wenn ich Deinen Text mißverstanden habe, kann dies durchaus auch daran liegen, daß Du Dich mißverständlich ausgedrückt hast. Ich verstehe den Kontext mit den verhungernden Kindern in Afrika einfach nicht – was war Deine Intention dabei?
Daß mit dem „vor dem Karren spannen“ finde ich interessant, da mir genau dies von der Gegenseite vorgeworfen wurde, weil ich mein Essay von Euch publizieren ließ. Mir wurde sogar nahegelegt, meine Zustimmung zur Veröffentlichung zurückzuziehen.
Möglicherweise lasse ich mich von Euch und von der Gegenseite „vor dem Karren spannen“ (am besten werde ich Einsiedler), aber meine Urteile fälle ich selber. Und bei Deinem Text habe ich nunmal starke Bedenken, soll ich Dir dann Beifall spenden, statt Kritik zu üben? Nur einmal so an alle Seiten gerichtet: Von mir bekommt ihr keine Nibelungentreue!
Werter Genosse Koelle, den Text zu Breivik hast Du schlicht und ergreifend nicht kapiert. Eine Gegenrechnung ist dort nicht gemacht worden. Schade, dass Du dich (mal wieder) vor Karren spannen lässt, die dir wenig bringen werden.
Hier nochmal ein paar Hintergründe zur Entstehung und Veröffentlichung des Essays.
Ich habe dieses Essay vor dem Hintergrund der Kandidatenaufstellung zur Kommunalwahl 2011 in Hannover geschrieben. So sehr auch die Vorabsprachen einiger Leute der Basisorganisation Linden-Limmer und die mangelnde Beteiligung an der Kandidatennominierung in Linden-Limmer das Bild einer offenen Kandidatenaufstellung stören können, besteht kein Zweifel daran, daß es eine Basisentscheidung zur Aufstellung der Kandidaten für den Stadtrat gab. Diese Entscheidung wurde wieder durch die Wahlversammlung des Kreisverbandes revidiert, auch auf Druck durch andere mächtige Gruppierungen im Kreisverband, die der Basisorganisation Linden-Limmer eher ablehnend gegenüberstehen. Letztlich muß sich aber gefragt werden, ob nicht genau diejenigen die Priorität bei der Kandidatenaufstellung haben sollten, die mit ihren Personentableau auch vor Ort den Wahlkampf gestalten müssen. Ähnliches spielte sich auch bei der Kandidatenaufstellung der FDP in Hannover ab, obwohl hier die Presse einen viel wohlwollenderen Ton anschlug.
Natürlich ist der Streit um die Kandidatenaufstellung zur Kommunalwahl nur ein Symptom eines grundsätzlicheren Konflikts, nämlich wie die Partei mit innerparteilichen Machtstrukturen umgeht. Insofern die Parteibasis hierbei zur Manövriermasse einer Herrschaftsclique innerhalb der Partei wird, muß analysiert werden, wie es zu diesem Gefälle kommt und welche Möglichkeiten der Gegenwehr bestehen. Strukturell ist die Analyse des Essays auf jede (bürgerliche) Partei anwendbar, allerdings liegt der Anspruch der Linken in der Überwindung von Herrschaft, weshalb hier die Reproduktion von Herrschaft besonders delikat ist. Keine Antwort bietet das Essay zu den innerparteilichen Flügelkämpfen (es wird nicht die horizontale sondern die vertikale Achse der Machtverteilung betrachtet).
In einer Vorabversion habe ich dieses Essay von Oliver Klauke über diverse Mailinglisten verteilen lassen, da dieses Essay wegen der kommunalen Kandidatenaufstellung in Hannover gerade aktuell war. In einer redigierten Version (die auch hier vorliegt) wurde es dann im Wissenschaftsnetz Sopos veröffentlicht (http://www.sopos.org/aufsaetze/4dda64b212366/1.phtml). Auf Anfrage wurde dieses Essay dann auf der Potemkin zur Veröffentlichung freigegeben.
Noch eine persönliche Anmerkung: Ich wurde ebenso kritisiert, dieses Essay durch Oliver Klauke verbreitet zu haben, wie es hier in der Potemkin veröffentlichen zu lassen. Die Vorwürfe kommen dabei jeweils von der Gegenseite. Jeweils wurde mir vorgeworfen, daß ich mich für fremde Interessen einspannen ließ. Wissenschaftliche Analysen beruhen zwar auf Paradigmen; sie sind aber nicht auf eine bestimmte politische Gruppierung ausgerichtet, sondern frei verwendbar (auch vom politischen Gegner).
Unschön ist allerdings, daß mein Essay genau neben den Text „Breiviks Leichenfledderer“ steht, der eine Nihilierung antifaschistischer Positionen beinhaltet. Von diesem Text distanziere ich mich ausdrücklich. Opfer faschistischer Gewalttaten können nicht mit verhungerten Kindern in Afrika gegengerechnet werden, ebensowenig wie Ausschwitz dadurch relativiert wird, daß mehr Menschen seitdem durch Hunger umgekommen sind.
Mit Mischa Koelle habe ich in vielen Fragen meine Differenzen – so sehe ich Politik weniger als Ausdruck bewusst handelnder Einzelakteure in ihrem Streben nach individueller „Macht“ – ein Begriff, der spätestens seit der Formulierung des positiven Machtbegriffes von Foucault auch in der anarchistischen Debatte nicht mehr in der von Koelle verwendeten Form gebraucht wird. Sprich: eine Strukturanalyse, die sich im Großen und Ganzen in linken Begrifflichkeiten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bewegt, ist meines Erachtens für die Darstellung aktueller politischer Problemfelder nur bedingt tauglich.
„Bedingt“ meint aber keineswegs „gar nicht“, und nehmen wir mal die Begrifflichkeiten weg, dann beschreibt Koelle hier mit dem Wahlboykott in den eigenen Reihen durchaus ein Problem, mit dem es sich auseinander zu setzen lohnte. Schließlich ist dergleichen für die LINKE kein zukünftiges Szenario, sondern unlängst bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz genauso eingetroffen: Nachdem eine knappe Stimmmehrheit auf dem LPT alle Listenplätze für „ihre“ Leute eingenommen hatte, weigerte sich die knappe Minderheit – also etwa die Hälfte der Ortsgruppen – Wahlkampf für diese Liste zu führen. Dies führte allerdings nicht zu einem erhofften Demokratisierungsschub, sondern zum totalen Zusammenbruch der Partei in Rheinland-Pfalz.
Ich denke von daher, dass der Wahlboykott kein aktives Mittel der Parteipolitik darstellen kann. Er ist viel mehr die erzwungene ultima ratio einer machtlosen Parteiminderheit gegenüber einer vollkommen unintegrativen Parteimehrheit in einem parteiinternen Grabenkampf, der dermaßen eskaliert und fest gefahren ist, dass ein Aufeinander zugehen nicht mehr möglich erscheint. Das Demokratiedefizit zeigt sich also weniger im Verhältnis der Basis zur „Führungskaste“, sondern in einem fragwürdigen Demokratieverständnis, das allein auf den Mehrheitsentscheid eingeengt wird, essentielle demokratische Kerninhalte wie Minderheitenschutz und Pluralismus aber vollkommen ignoriert. Deswegen erscheint es mir, um Desaster wie in Rheinland-Pfalz – und ich befürchte, dass Rheinland-Pfalz Angesichts der Entwicklung in den Westverbänden da in negativer Weise eine Avantgarde-Funktion einnehmen wird – in Zukunft zu vermeiden, der Modus der innerparteilichen Entscheidungsfindung weg von der Mehrheitsdiktatur hin zur Verhältniswahl geändert werden muss.
Ich möchte damit nicht sagen, dass der Konflikt zwischen „Führungskaste“ und Basis nicht existiert. Aber dieser Konflikt existiert erst deswegen, weil unser Wahlsystem für die Bildung derartiger elitärer Zirkel anfällig ist.
Ich teile etliche Ansichten von Koelle nicht. Der Text ist aber im Kreisverband diskutiert worden und bietet, im Gegensatz zur plumpen „Analyse“ von dubcek, Ansatzpunkte einer theoretischen Debatte zur innerparteilichen Demokratieentwicklung. Gerade das Fallbeispiel Hannover zeigt, dass eine solche Debatte notwendig ist. Der Text wurde übrigens von Marx 21 „Kader“ Oliver Klauke verbreitet, weil ein ihm nicht genehmer Kandidat in „seiner“ BO Spitzenkandidat wurde.
So einen wirren [moderiert] habe ich lange nicht mehr gelesen. Ich gebe zu, ich habe es aus Fremdscham nicht ganz lesen können. Voll prima, wenn man sich Basis nennt und so schreibt, dass diese es nie verstehen wird – und dass obwohl man sich inhaltlich auf Bild-Zeitungs-Niveau bewegt. Warum darf [moderiert] hier eigentlich schreiben?
Anmerkung der Redaktion: Der Kommentar wurde um nicht angebrachte Ausdrucksweisen erleichtert. In Zukunft sollte man sich doch einer halbwegs zivilisierten Ausdrucksweise bedienen, wenn Kritik geübt werden soll. Die Nennung des eigenen Namens sollte dann selbstverständlich sein. Auffallend, dass sich solche Kommentare häufen, wenn hier Texte von studierenden Genossen und / oder über das Wirken der Linken an der Hochschule erscheinen. Offensichtlich besteht noch Nachholbedarf in Sachen Diskussionskultur. (mb)