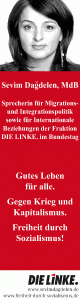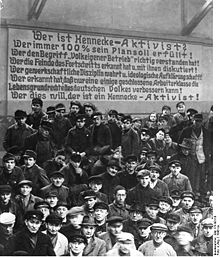von Matthias Zwack
„Alright Internet, what do you want from us? If we angered you somehow, let us know!“ – South Park
Die 15 Mann auf der Totenmannskiste waren sie zwar nicht gerade, aber zumindest Anzahl (und Geschlechterrolle) der Crew stimmte, welche am Sonntag, den 18.9.2011, das preußische Landtagsgebäude enterte. Da derartige Veränderungen im bundesdeutschen Parteiensystem eher selten passieren, war das Erstaunen in Politik und Medien entsprechend groß. Und auch wenn die Berliner Piraten mit ihrem braven, nerdigen Erscheinungsbild und ihrer fast schon sympathischen und bodenständigen Unbekümmertheit, ja, beinahe möchte man sagen: Hilflosigkeit, so gar nicht wie echte Schrecken der sieben Weltmeere wirken mögen, ganz piratenmäßig waren auf jedem Fall Angst und Schrecken, die ihre Kaperfahrt in den Köpfen der Wahlbeobachtenden verbreitete. Ihr Heimathafen, so munkelte es durch Fernsehen und Zeitungen, läge wurde nämlich in einem unberechenbaren, weitestgehend unkartographiertem, und somit mysteriösem und Mythenumwobenem Gewässer: Dem Internet. Immer wieder wird auf die Wurzeln der Piraten in der Hackerszene verwiesen und fest gestellt, diese würden vor allem die „internetaffine“ Jugend ansprechen und mit „netzpolitischen Themen“ Punkte sammeln. Unisono wird ihnen damit bescheinigt, ein gesellschaftliches Phänomen verstanden und besetzt zu haben, dessen Mechanismen und Wirkungsweisen den „traditionellen“ Parteien mehr oder minder verborgen bleiben. Darüber, was dieses Internet eigentlich sein soll, geschweige dem, wie es politisch zu besetzen und zu erobern ist, herrscht Ratlosigkeit, macht sich ein gewisses Unbehagen bereit.
Interessant an dieser Verknüpfung von Piraten und Internet ist die tatsächliche Diskrepanz zwischen der Zuordnung der beiden Begriffe im öffentlichen Diskurs auf der einen, der Tatsache, dass netzpolitische Themen im Wahlkampf der Partei aber eigentlich im Gegensatz zu etwa den Rubriken Open Gouvernment, öffentlicher Nahverkehr, Drogenpolitik oder Grundeinkommen eine eher untergeordnete Rolle gespielt haben auf der anderen Seite. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hierbei um eine künstliche Verknüpfung zwischen dem Wahlerfolg der Piraten und dem Medium Internet handelt, die im Endeffekt vor allem was über die Haltung der Öffentlichkeit zum World Wide Web aussagt, denn über die Haltung der Piraten zu eben jenem. Die in den Kommentar- und Klatschspalten offenbarte Vorstellung über das Internet scheint nämlich die einer Art zur analogen Realität parallel laufenden, digitalen Alternativgesellschaft zu sein, die irgendwelchen eigenen, von außen nicht verständlichen Regeln gehorcht. Aus dieser Vorstellung heraus scheint für viele Beobachter aufgrund der vorgeblichen Unkontrollierbarkeit dieses Mediums eine unmittelbare Bedrohung für die Analogwelt abgeleitet zu werden: Die zahllosen Versuche von politischer Seite, durch Verbote von „Hacker-Tools“ und „Killerspielen“, Netzsperren, Datenspeicherung, Stoppschildern und anderen Absurditäten die vermeintlich ungezügelte Online-Welt als modernes Sündenbabel in ihre Schranken zu weisen, sprechen ebenso für die These, wie etwa das fast schon religiöse Erstaunen über den Obama-Wahlkampf 2008, welcher angeblich „so gut mit dem Internet“ umgehen konnte und die im Fernsehen bei Wahlen und großen politischen Ereignissen wie dem „arabischen Frühling“ immer häufiger zu sehende Live-Berichterstattung aus Facebook, Twitter & Co., welche den Charakter säkularer Gottesdienste, also einer Fetischisierung der Netzwelt als unergründliches, aber mit enormer Bedeutung aufgeladenes Mysterium annehmen.
Interessant ist aber auch, dass gerade „netzpolitische“ Bewegungen wie etwa die Piraten ebenso dieser Fetischisierung des Digitalen auferliegen. Von der anderen Seite aus gesehen, versteht sich. Für die Piraten scheint das Motto zu gelten: Was im Internet funktioniert, muss doch in der Gesellschaft „da draußen“ auch gelten können. Will man den Piraten also so etwas wie eine Agenda unterstellen, dann läge diese darin, die gesellschaftliche Spaltung zwischen Alltag und Internet zu überwinden und digitale und analoge Welt miteinander zu versöhnen. So wirklich scheint sich dabei der Gedanke noch nicht ganz durchgesetzt zu haben, dass die Welt da draußen nach anderen Regeln funktioniert und andere Prioritäten setzt als der Code eines Computerprogramms. Symptomatisch dafür sind nicht nur die etwas verplanten Äußerungen des Berliner Piratenkapitäns Andreas Baum in letzter Zeit, etwa bezüglich des Berliner Schuldenberges („ein paar Millionen“), der Kriminalitätsbekämpfung („dasselbe wie alle anderen Parteien auch“) oder der politischen Priorität, was als erstes in Angriff genommen werden sollte (Twitter-Erlaubnis im Abgeordnetenhaus), sondern z.B. auch die vollkommene Ignoranz von äußerst realen Herrschaftsmechanismen, wie etwa den einer gesellschaftlich virulenten patriarchalen Heteronormativität oder der Umgang mit rechten Gedankengut in den eigenen Reihen.
Diese Vorstellung von einer parallel laufenden Online Offline-Gesellschaft zeigt eigentlich nur, dass ein großer Teil der Bevölkerung die digitale Revolution vollkommen verschlafen hat. Denn das „Wesen“ des Internets – sofern überhaupt von einem solchen geredet werden kann .-ist eigentlich ganz banal: Es ist ein von Menschen gemachtes und potentiell den Menschen dienendes Werkzeug, mit dem sich gewisse gesellschaftliche Arbeiten verrichten lassen, nicht anders, als etwa ein Faustkeil, ein Musikinstrument oder eine Plastiktüte. Das Netz mag zwar ein mächtiges, wichtiges und sicher auch „revolutionäres“ Instrument sein, mit dem sich verschiedene Aufgaben wie Kommunikation, Informationsaustausch und Kreativität in einer bisher nie dagewesenen Qualität und Quantität bewerkstelligen lassen. Aber diejenigen, die es benutzen, sind ganz normale Menschen aus Fleisch und Blut, die sich tagtäglich in der ganz normalen gesellschaftlichen Realität begegnen, sich aufgrund ihres hauptsächlich dort gewonnen Erfahrungsschatzes verhalten und ganz materiellen sozialen Verhältnissen unterworfen sind und diese reflektieren. Umgekehrt wirkt sich der Siegeszug des Internets, und damit die mit diesem Werkzeug einhergehenden Innovationen, wie bei jeder Einführung eines neuen Werkzeugs, wiederum auf die Gesellschaft als Ganzes aus.
Von daher existiert die so häufig postulierte soziale Parallelität von Materialität und Virtualität schlicht und einfach nicht: Das Internet schafft zwar Möglichkeiten der Kommunikation und bietet Raum für umfassende soziale Experimente, etwa neue Formen der demokratischen Partizipation, wirft gleichzeitig aber auch neue Probleme auf. Nicht reflektiert wird dabei aber, dass diese digitale Welt gerade für die jüngeren Semester (wozu allerdings genau genommen, wenn es um die Selbstverständlichkeit digitaler Medien geht, schon die Generation bis 30+ gerechnet werden müsste) gewissermaßen völlig normaler Bestandteil ihrer Alltagswelt ist, dass sie eine Erweiterung, keineswegs aber eine Alternative der materiellen Realität bietet und dass sich die beiden Sphären analog und digital streng genommen überhaupt nicht voneinander trennen lassen.
Und ganz genau dort liegt der Punkt, an dem eine progressive, emanzipatorische Netzpolitik ansetzen kann: Sie sollte sich vom Fetischcharakter des Internets lösen, und sich lieber auf die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen dieses Mediums konzentrieren, um von diesem Standpunkt aus linke Positionen präsentieren zu können. Vier Aspekte des Mediums Internet erscheinen mir dabei besonders wichtig: Kommunikation, Partizipation, Konsum und Ökonomie.
Kommunikation
Der Aspekt der Kommunikation ist vielleicht derjenige, der sich den Durchschnittsuser_innen am meisten erschließt. Egal, ob in Form von privaten Homepages und Blogs, über Telefon- und Chatdienste wie Skype und ICQ oder durch das Posten auf Facebook – die meisten Menschen benutzen das Internet als Mittel gegenseitigen Austausches. Dabei lässt das Netz aber nicht etwa Kommunikation im Allgemeinen, sondern, ebenso wie vordigitale Kommunikationsmethoden vom Brief bis zum Telefon, sondern eher bestimmte Arten von Kommunikation zu und schafft neue Formen des zwischenmenschlichen Umgangs miteinander. Einerseits war es wohl nie so möglich so schnell mit so vielen Leuten auf der Welt gleichzeitig in Verbindung zu treten wie im digitalen Zeitalter: Etwa 1,5 Milliarden Menschen haben weltweit regelmäßigen Zugang zum Internet. Auf der anderen Seite ist der Internetzugang damit aber auch zu einem sozialen Ausschlusskriterium geworden, welches in der Regel als „digitale Kluft“ bezeichnet wird: Weltweit nutzen nur etwa 17 Prozent dieses Medium, während der Rest aus verschiedenen, etwa infrastrukturellen, ökonomischen, oder auch Altersgründen davon ausgeschlossen wird. Auch in der EU leben immerhin noch etwa 40% der Bevölkerung permanent Offline. Allein auf Grund solcher Umstände ist die viel gelobte angebliche „Offenheit“ des Internets schon einmal prinzipiell anzuzweifeln: Global gesehen kann nur eine Minderheit das Medium Internet frei nutzen. Politisch gesehen könnte es also darum gehen, diese digitale Spaltung zu überwunden. In Estland etwa ist der Staat dazu verpflichtet, allen Bürgern einen kostenlosen Internetzugang zu gewährleisten, ein für eine egalitäre Linke unbedingt nachahmenswertes Modell. Auch Forderungen nach flächendeckender Anbindung aller durch leistungsfähige Bandbreitnetze und der möglichst kostengünstigen Bereitstellung von Endgeräten wie Computern und Smartphones wären aus dieser Perspektive heraus eigentlich nur logisch und konsequent.
Nun sind die Möglichkeit eines Internetzugangs und die Art und Weise, wie man diesen auch wirklich nutzt, zwei ganz verschiedene Dinge. Millionen von Menschen fallen auf vermeintliche Online-Angebote herein, installieren aus Unwissenheit Malware und machen ihre Computer damit zu Virenschleudern für große, kommerziell genutzte Zombiefarmen und geben aus Unkenntnis auf Facebook, Google & Co. ihre Privatsphäre völlig auf. Das Stichwort des „Gläsernen Users“, dessen Daten von Unternehmen zu kommerziellen Zwecken genutzt und getauscht werden, sowie die Möglichkeit der gegenseitigen Überwachung aller sozialen Aktivitäten und persönlichen Vorlieben untereinander, sind äußerst reale Probleme, die medial in der Regel zu Schreckensszenarien aufgebauscht werden, allerdings ohne, dass gleichzeitig sinnvolle Tipps gegeben werden, wie man sich sinnvoll gegen derartige Selbstentblößungen wehren kann. Forderungen nach Verboten und gesetzlichen Einschränkungen sind jedoch sehr vorsichtig zu betrachten: Meistens bedeuten sie nur die Einführung von staatlichen Eingriffen in die Kommunikationsfreiheit des Internets, die durchaus als Zensurmaßnahmen bezeichnet werden können, während der protektionistische Nutzen gerade in einem solch dynamischen System wie dem Internet, das erfahrenen User_innen immer die Möglichkeit einer Umgehung bietet, getrost bezweifelt werden darf.
Emanzipatorische Politik sollte dem einen aufklärerischen Ansatz entgegen stellen, also darauf hinarbeiten, dass die Menschen sich bei der Nutzung eines Mediums erst einmal der Funktionsweise dieses Mediums bewusst werden. In dieser Hinsicht herrscht noch gewaltiger Nachholbedarf. Sinnvoll wäre es von daher, bereits möglichst früh auf einem vernunftbetonten Umgang mit dem Internet hin zu arbeiten und möglichst praxisnahe Methoden aufzuzeigen, wie wirkungsvoll und nachhaltig gegen Attacken aus dem Internet geschützt werden kann. Die Palette an aufklärerischen Maßnahmen müsste dabei eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Technologie des Internets beinhalten und eine breite Spannweite, angefangen bei Banalitäten wie sinnvollen Konteneinstellungen bei Online-Diensten und Installation von Sicherheitswerkzeugen wie Anti-Viren-Scannern, Skriptblockern etc., bis hin zu schweren Geschützen wie einer ordentlichen Rechteverwaltung in Betriebssystem und der Einrichtung von Proxy-Verbindungen für anonymes Surfen ohne digitale Fingerabdrücke zu hinterlassen, reichen. Im Mittelpunkt solcher Schulungen dürfte dabei auch die Erkenntnis stehen, dass derartige Sicherheitsmaßnahmen nicht schwierig und kompliziert, sondern eigentlich sehr einfach und intuitiv zu bewerkstelligen sind, wenn einmal die Grundprinzipien bekannt sind. Vor allem muss klar gemacht werden, dass derartige Überlegungen nichts (nur) für Computernerds, sondern selbstverständliche und notwendige Techniken zur Netzbenutzung sind, etwa so, wie das Bedienen einer Telefontastatur für den Gebrauch eines Mobiltelefons.
Partizipation
Auch unter die Rubrik „emanzipativer Umgang mit dem Internet“ fällt die Debatte um Offenheit, Transparenz und Mitentscheidung im Internet. Viele Projekte, die symptomatisch für die digitale Gesellschaft sind, etwa die Online-Enzyklopädie Wikipedia, werden nicht zentral geplant und ausgearbeitet, sondern entstehen durch dezentrale, egalitäre Zusammenarbeit vieler User an dem Projekt. Und in vielen Foren und Blogs ist es prinzipiell allen User_innen möglich, über bestimmte, oft von der Community selbst vorgegebene Themen mit zu diskutieren. So begrüßenswert die Möglichkeiten dieser Kulturtechniken auch sind, so falsch ist die Fehlinterpretation dieser Techniken als Formen der „Online-Demokratie“. Die Offenheit der Netzdiskussionen lässt nämlich ganz neue Macht- und Herrschaftstechniken zu, deren Anwendung sich, außer mit repressiven Maßnahmen, die dann aber wiederum den Sinn der offenen Kommunikation bedrohen würden, kaum sinnvoll begrenzen lässt. In der Anonymität des Internets ist es nämlich leicht, die eigenen Ziele und Methoden zu verbergen. Bekannte „unfaire“ Mittel der Steuerung einer Diskussion zum Zwecke einer eigenen Diskurshegemonie sind etwa das Auftreten als koordinierte Gruppe innerhalb einer Diskussionsrunde, von deren Absprachen die übrigen User_innen nichts wissen, oder gleich die Beeinflussung einer Diskussion durch „Sockenpuppen“, also Fake-Accounts, die vorgeben, verschiedene Personen zu sein, aber in Wirklichkeit von einer Person gesteuert werden. Ebenso berüchtigt ist das Phänomen der „Forentrolle“, also der gezielten Einbringung kontroverser Themen zur Chaotisierung einer einem selbst unliebsamen Diskussion. Verantwortungsbewusste Seiten-Administrator_innen versuchen zwar, derartige Methoden zu unterbinden, aber ganz ausschließen lässt sich der Erfolg solcher Mittel in einem Medium, das keine eindeutigen Namen und Gesichter zuweist (eine ansonsten im Übrigen sehr positive Sache), nie. Auf der anderen Seite besteht das Problem, dass die Moderation in vielen Fällen – berechtigterweise – nach eigenen Kriterien moderiert und nie ganz kontrollierbar ist.
Um es kurz zu sagen: In der Diskussionskultur des Internets eine Form der Demokratie zu sehen, ist schlicht und einfach falsch und geht an der Realität vorbei. Denn zwar ist die prinzipielle Möglichkeit der Partizipation gegeben, mit der Repräsentation schaut es aber anders aus. Über Online-Abstimmungen oder Foren-Posts erzeugte „Stimmungsbilder“ oder gar Extremmaßnahmen wie die Praxis der Piratenpartei, ihr Parteiprogramm über ein Online-Wiki zu erstellen, können deshalb nie demokratisch sein und sollten auf keinen Fall Einzug in das Netzverhalten linker Politik halten. Auf der anderen Seite sind die Möglichkeiten der aktiven Teilhabe, sowie der größtmöglichen Offenheit und Transparenz politischer Entscheidungen und ihrer Entstehung, die das Internet bietet, überaus begrüßenswert, genauso wie Möglichkeit, sich anonym zu Wort zu melden und der eigenen Stimme auch ohne die Angst vor Konsequenzen Gehör zu verschaffen.
Konsum
Das Internet ist nicht nur eine Plattform für Ideenaustausch, sondern auch ein großer Marktplatz, der von Online-Shops wie Amazon oder eBay dominiert wird. In der Öffentlichkeit wird dabei allerdings oft zwischen „guten“ und „schlechten“ Konsum unterschieden. Letzterer läuft vor allem unter dem Label „Filesharing“, also dem unentgeltlichen Austausch von urheberrechtlich geschütztem Material wie Filme, Musik, Computerspiele etc. über Torrents oder Filehoster. Aus einer linken Perspektive müsste diese Möglichkeit eigentlich uneingeschränkt begrüßt werden, führt sie doch dazu, dass Kulturgüter der Allgemeinheit ohne Kostenaufwand zur Verfügung gestellt werden können.
Dennoch wird gerade von Seiten der Rechteinhabenden massiv gegen diese Form des freien Informationsaustausches Stimmung gemacht und Filesharer_innen sind der stetigen Gefahr von Unterlassungsklagen ausgesetzt. In manchen Ländern, auch wieder aktuell in der BRD, wird sogar unter dem Kampbegriff „Three Strikes“ darüber diskutiert, Menschen, die einer solchen Urheberrechtsverletzung überführt werden, den Internetzugang einzuschränken. Auch hier ist die Grenze zwischen Schutz von Urheberrechten und staatlicher Zensur schwer zu ziehen. So dürfen etwa die öffentlich-rechtlichen Sender in der BRD ihre Sendungen nur für eine gewisse Zeit online stellen und müssen sie dann später löschen. Und gerade deutsche User_innen wissen, wie ärgerlich es ist, wenn man einen neueren Video-Clip sucht, nur um dann mit der Nachricht: „Dieses Video ist in ihrem Land nicht verfügbar“ begrüßt zu werden. Gerade die Frage des Themas „Urheberrecht vs. Informelle Selbstbestimmung“ ist eine Thematik, in der sich eine linke Netzpolitik besonders profilieren könnte. So ist z.B. die rechtliche Legitimität der strafrechtlichen Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen ziemlich umstritten, war das Anfertigen und Tauschen von Sicherheitskopien doch auch schon in Zeiten von VHS und Audiotape gängiger Usus. Und ein direkt durch Filesharing verursachter wirtschaftlicher Schaden für die Urheberrechtsinhabenden konnte bisher auch nicht nachgewiesen werden.
Auf der anderen Seite muss aber auch hinterfragt werden, ob alternative Konzepte, etwa das einer so genannten „Kultur-Flatrate“, nach der alle potentiellen Konsumierenden einen bestimmten Betrag pro Monat an die Gema überweisen und dafür Dateien herunter laden können, wie sie möchten, wirklich einen Fortschritt darstellen. Der Vorteil dieses Modus gegenüber Online-Tauschbörsen leuchtet nämlich nicht wirklich ein. Viel mehr erinnert dieses Konzept an das Modell der GEZ zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioprogramms. Dass das durch die Flatrate erwirtschaftete Geld dann irgendjemand anderen hilft als Universal, Fox & Co., darf aber mal gehörig bestritten werden, ebenso wie Behauptung, die downloadbaren Inhalte wären dann „frei“, würden diese dann doch nur den Leuten mit Flatrate-Zugang zur Verfügung stehen. Außerdem ist die Entrichtung eines Einkommensunabhängigen Pauschalbetrages zutiefst unsozial.
Linke Urheberrechts -Politik sollte eher ein grundsätzliches Bekenntnis zur allgemeinen Verfügbarkeit von Kulturgütern über das Internet als Grundrecht beinhalten und die Frage nach den Auswirkungen auf den Profit der Unternehmen mal lieber diesen selbst überlassen. Es gibt ja bereits eine Reihe von kommerziellen Modellen, bei denen man sich etwa Fernsehsendungen kostenlos auf durch Werbung finanzierten Websites anschauen kann (wobei die Beendigung der Werbebelästigung durch die Nutzung von Adblockern grundsätzlich allen frei steht). Es kann aber nicht Aufgabe linker Netzpolitik sein, für den Profit großer Medienkonzerne zu sorgen.
Ökonomie
Im Zusammenhang mit Netzpolitik oft und viel diskutiert wird das „Open Source“-Konzept, also von Software, aber im zunehmenden Maße auch anderen Produkten wie 3D-Druckern etc., die nicht nur frei allen zur Verfügung stehen, sondern deren Programmcodes bzw. Bauanleitungen „offen“, d.h. für alle einsehbar und somit auch nachbau- und erweiterbar sind. Oftmals wird dieses Konzept im Zusammenhang mit dem so genannten „commons“-Konzept als Alternative zur kapitalistischen Produktionsweise beworben: Im Gegensatz zu normalen Produkten, deren Baupläne und Vertrieb rechtlich gesichert exklusiv einzelnen Marktanbietern gehören, gehören Open-Source-Produkte der Allgemeinheit. Aus einer linken Perspektive heraus ist diese Entwicklung zusammen mit anderen, auch zunächst über das Internet verbreiteten, alternativen Urheberrechtskonzepten wie der „creative commons“-Lizenz, auf jedem Fall unterstützenswert. Open Source befreit die User_innen von den Launen des Marktes und gibt ihnen ein Stück Entscheidungsfreiheit und Selbstkontrolle über die von ihnen verwendeten Güter zurück. Auch dieser Text hier ist mit einem Open Source-Schreibprogramm auf einem Open Source-Betriebssystem verfasst und der Autor hat damit wesentlich weniger Schwierigkeiten als mit seinem Windows 7, das meist unberührt friedlich auf einem anderen Teil seiner Festplatte schlummert. Open Source hätte also durchaus das Potential, eine neue, gemeinschaftlich kontrollierte Ökonomie jenseits des Kapitalismus aufzubauen und könnte damit auch außerhalb der digitalen Welt Schule machen.
Allerdings sind auch hier Einwände angebracht. So erlauben viele Open-Source Lizenzen die Verwertung des Codes zu wirklich allen Konditionen und machen es damit auch möglich, dass der Code oder Teile des Codes kommerziell vermarktet werden können. Unternehmen wie Google, Red Hat, oder Canonical – bekannt für die Linux-Distribution „Ubuntu“ – haben sich bereits auf den Vertrieb derartiger Form der Software spezialisiert und scheffeln mit den Früchten der Arbeit von Freizeit-Programmierenden Profit. Was hier als innovative, gemeinschaftliche Form des Wirtschaftens jenseits des Kapitalismus verkauft wird, wirkt vor diesem Hintergrund eher wie eine Eskalationsstufe der Selbstausbeutung der Digital Boheme: Die idealistische Hobby-Bastler_in arbeitet ja in der Regel in ihrer Freizeit und unbezahlt, das heißt, sie wird für ihre Arbeitskraft gar nicht mehr entlohnt, sondern verrichtet ihre Dienste in der Freizeit. Von „Ausbeutung“ im klassischen Sinn kann dabei gar nicht mehr gesprochen werden, denn einen Arbeitsvertrag gibt es hier nicht mehr, geschweige dem irgendeine Form von Vergütung. Statt dessen führt die Illusion, „selbstbestimmt“ und „freiwillig“ zu arbeiten, dazu, dass sich die Arbeitenden mit den von ihnen geschaffenen Produkten identifizieren und gar nicht mehr erkennen, dass sie längst nicht mehr ihnen gehören. Hier offenbart sich der kapitalistische Arbeitsfetisch par excellence: Lohnarbeit wird nicht als eine strukturbedingte Notwendigkeit in der Verwertungslogik einer kapitalistischen Gesellschaft begriffen und kritisiert, sondern stellt einen erstrebenswerten Wert an sich dar. Originell und neu ist das nicht gerade. Vielmehr wird hier ein Problem des Kapitalismus als dessen Lösung verkauft.
Zusammengefasst besteht eine unbedingte Notwendigkeit der Linken, sich mit dem Thema „Netzpolitik“ auseinander zu setzen und eigene Positionen zu entwickeln. Ein linker Politikansatz sollte sich dem Thema dabei gleichermaßen emanzipativ und emanzipatorisch annähern. Am Anfang einer solchen Politik muss das Verständnis des Internets als ein die Gesellschaft revolutionierendes und in sie einwirkendes Werkzeug, aber nicht als von der Gesellschaft unabhängiger Eigenwert, oder gar einer fetischhaften Mystifizierung desselben, stehen. Als von Menschen gemachtes Artefakt muss es dabei für die Menschen und durch die Menschen funktionieren und darf nicht zur Unterdrückung und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zweckentfremdet werden. Dass das Internet davon derzeit weit entfernt ist, liegt unter anderem auch daran, dass die Politik im Allgemeinen und damit auch linke Politik im Spezifischen es bisher versäumt hat, sich Gedanken über dieses Werkzeug zu machen. Es ist also dringend an der Zeit, dafür zu sorgen, dass das Internet ein Medium wird, in dem die Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und Partizipation gelten und von diesem aus in den Rest der Gesellschaft ausstrahlen.
Dies wäre auch der wünschenswerte Ansatz, der eine linke Netzpolitik von der anderer politischer Strömungen, etwa der Piraten, unterscheidet: Diese stellen nämlich die der Netzkultur zu Grunde liegenden gesellschaftlichen Verhältnisse in keiner Weise in Frage. Im Gegenteil ist ihnen daran gelegen, diese durch neue, „innovative“, aber nicht unbedingt im Sinne der Produzenten gerechte Reformen verbessern und erneuern. Oder, wie es ein Pirat jüngst auf dem Online-Forum „Lafontaines Linke“ ausdrückte: „Abseits der Kampfrhetorik wird fleißig an einem vollbeschäftigten, sozialeren, multikulturelleren, gegenderten und straffer regulierten, ›nachhaltigen‹ Kapitalismus“ – einer Art „Kapitalismus 2.0“ also – gebastelt. Linke Netzpolitik sollte aber nicht die Reform der kapitalistischen Produktionsweise im Sinn haben, sondern deren Abschaffung. Das gilt im Digitalen ebenso wie im Analogen.